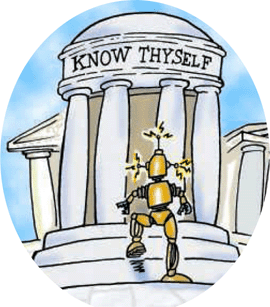 Credit: Joe Sutliff Science 314:109 |
Auf
dem Weg über den Menschen
hinaus?
|
|
Transhumanismus - also die Erweiterung der natürlichen Ausstattung des
Menschen ,wie Gott ihn schuf' durch Hinzufügung künstlicher Module -
stellt zunehmend eine Herausforderung für unsere Werteordnung dar. Wie
sollen wir derart ,erweiterten' Wesen begegnen? Muss man sich vor ihnen
fürchten? Soll man Manipulationen dieser Art unter Kuratel stellen?
Welche technischen Entwicklungen sind vorauszusehen, und wo liegen
mögliche Gefahren? Im Folgenden unternehme ich einen Erklärungsversuch,
warum wir technische Entwicklungen, die unsere Fähigkeiten über das
heute Mögliche hinaus steigern, nicht fürchten sollten. Im
Gegenteil: wir dürfen weltweit auf die Lösung von Konflikten hoffen und
auf das Kommen eines friedlichen Zeitalters. |
| Der christliche Ausgangspunkt |
|
Als Jesus vor den Hohen Rat gezerrt wurde und man ihm den Prozess machte,
zerriss – nach kurzem Verhör – der Hohenpriester Kaiphas seine Kleider und
rief: „Er hat Gott gelästert! Was brauchen wir noch Zeugen?“ Und alle stimmten
darin überein, dass er des Todes schuldig sei (Mt 26:65). Wodurch hatte Jesus den
Mann denn so in Rage gebracht? Er hatte ausgesagt, der Sohn Gottes zu
sein. |
|
Heute würde man mit einer solchen Aussage eher auf Unverständnis und Milde
stoßen. Der alte Gott der Juden, dessen Name bis zum heutigen Tag nicht genannt
werden darf, so himmelweit steht er über den kleinen Menschen; dieser Gott ist
damals in Jesus Mensch geworden. Das wurde zum Gründungs-Mythos des
Christentums: Jesus verkündete das Ende der alten religiösen Ordnung und deren
Ablöse durch eine neue. |
|
Gott wurde von einer Frau geboren, wie andere Menschen auch, von der Mutter
Gottes. Gott wuchs in einem Handwerker-Haushalt auf, hatte Freunde, führte
philosophisch-religiöse Streitgespräche, fand Gleichgesinnte, Mitstreiter und
Weggefährten. Er fand mit seinen Ideen und Vorstellungen große Resonanz, wurde
weit über seinen Freundeskreis hinaus im ganzen Land bekannt. |
|
Und Gott eckte an bei den Vertretern und Bewahrern der alten Ordnung, die
ihn lieber weiter so sehen wollten wie seit Jahrhunderten gewohnt.[a]
Schon allein die Vorstellung, Gott könnte als Mensch gedacht werden, mit all
seinen menschlichen Schwächen und Verwundbarkeiten, war für sie unerträglich
und die schlimmste aller vorstellbaren Blasphemien. [a] „Er war in der Welt, und die Welt war durch ihn geschaffen worden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf.“ Jo 1:10-11 (nach A. Zwettler, Heilige Schrift des Neuen Bundes, Veritas 1965) |
|
Und schließlich: Gott starb. Er starb einen für damalige Verhältnisse
ziemlich schimpflichen und grauslichen Tod. Nur in manchen christlichen Kirchen
wirkt sein Hängen am Kreuz wie eine Erhöhung, wie ein Triumph, oft geschuldet
den üppigen Verzierungen und Goldverbrämungen rundherum. Die Tötung an erhöhter
Stelle diente damals der Abschreckung: jeder sollte mitbekommen, wie mit
Solchereinem zu verfahren ist. |
|
Im Evangelium nach Johannes sind die letzten Worte Jesu am Kreuz schlicht
und einfach: „Es ist vollbracht“ (Joh 19:30). Gott hatte das Menschsein bis zum
letzten Augenblick durchgehalten. Dieses historische Ereignis – so
unspektakulär es in der damaligen Öffentlichkeit auch wahrgenommen wurde –
markiert den Beginn des Christentums und der westlichen Zeitrechnung. Das Kreuz
wurde zu seinem zentralen Symbol, wie um zu unterstreichen dass Gottes Tod
entscheidend war. |
|
Auch im 21. Jahrhundert kann es nicht schaden, hin und wieder diese
christliche Ursprungserzählung Revue passieren zu lassen, um nicht verunsichert
zu werden von Neunmalklugen, die gemäß Nietzsches Dictum[b]
„Gott ist tot“ einem aufgeklärten Atheismus das Wort reden wollen. Aufgeklärt
sind wir in großen Teilen der modernen Welt sehr wohl, aber dass Gott gestorben
ist, wissen und verkünden die Christen seit 2000 Jahren.[c] [b] Friedrich Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft, 3. Buch, Aphorismus 125 (1882) [c] Zu Lebzeiten ist es Jesus nicht gelungen, sich
seinen Jüngern zu offenbaren, auch wenn er es versucht hat: „Philippus sagte zu
ihm: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus entgegnete ihnen:
Solange schon bin ich mit euch beisammen, und du kennst mich noch nicht,
Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, wie kannst du sagen:
Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater
in mir ist?“ Jo 14: 8-10 (nach A. Zwettler). Der Groschen fiel bei den Jüngern
erst später (die Christen gedenken dieses Ereignisses zu Pfingsten). Wie fremd
diese Gedanken vielen Repräsentanten aktueller christlicher Kirchen heute schon
geworden sind kann man u. a. auch daran ermessen, dass der vorliegende Text, an
sich erbeten für eine Sondernummer von Imago Hominis (einem der
Österreichischen Bischofskonferenz nahestehendem periodischen Druckwerk)
schließlich doch abgelehnt wurde mit dem geäußerten Verdacht, der Schreiber
wolle sich über die Kirche lustig machen… Siehe auch ‚Was Jesus wirklich sagte‘
von Gerhard Schwarz, Molden, Wien 1971; neu aufgelegt Edition Va Bene, Wien
2007; Hoffen auf Vernunft (1/15); Kein Gott mehr? (8/17) |
|
Neue Technologien |
|
Im Lichte dieser von Jesus begründeten neuen religiösen Ordnung: was sollte
man halten von Fantasien und Bestrebungen, einen neuen, verbesserten,
gesteigerten Menschen zu schaffen mit modernsten technischen Mitteln? Einen
Menschen mit schärferen Sinnen, verstärktem Glücksgefühl, verlängerter
Lebensspanne, erhöhter Leistungsfähigkeit? Sollten Christen da nicht (wie
damals Kaiphas) aufstehen und ihre ‚Kleider zerreißen‘? |
|
Es gibt einige wenige christliche Gesellschaften die technischen
Errungenschaften skeptisch gegenüberstehen.[d]
Der christliche Mainstream hat in diesem Zusammenhang kaum Berührungsängste,
und zwar aus einem einfachen Grund: Die Christen sind mit Jesus aus der Welt ‚heraus
gestorben‘ in eine neue Welt, in der das Geistige Vorrang hat vor dem
Materiellem. Den Christen ist es nicht wichtig, was man tut, sondern mit
welcher Einstellung man es tut.[e] [d] Beispiele sind die Amish in den USA und die Zeugen Jehovas. [e] „Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst nicht
töten. … Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder zürnt, soll dem Gericht
verfallen.“ Mt 5: 21. „Ihr habt gehört, dass gesagt wurde: Du sollst nicht
ehebrechen. Ich dagegen sage euch: Jeder der ein Weib nur begehrlich ansieht,
hat schon in seinem Herzen Ehebruch mit ihr begangen.“ Mt 5: 27-28 (nach A.
Zwettler) |
|
Diese ‚innere‘ Haltung bezieht sich auch auf moderne Technologien. Christen
müssen ihre Religion nicht neu erfinden, um den neuen Technologien gegenüber
gewappnet zu sein. Seit Jahrhunderten verbessern wir den Körper des Menschen,
und wenn es nur durch das Tragen einer Brille oder das Anpassen einer Prothese
geschieht. Keinem Christen würde so etwas als unstatthaft erscheinen.
Inzwischen sind wir sogar schon in der Lage, so manchem Ertaubten den Gehörsinn[f]
und so manchem Erblindeten den Sehsinn[g]
(zumindest rudimentär) wiederzugeben. [f] Cochlea-Implantate können an die Stelle eines funktionslosen Innenohrs treten und Schall in ein Signal umwandeln, das an den Hörnerv weitergegeben wird. [g] Lichtsensitive Implantate in die Retina mit Verbindungen zum Sehnerv sind
inzwischen in der Lage, Bilder sehr grober Auflösung an die Sehrinde zu
vermitteln. |
|
Warum sollten wir hier haltmachen? Wenn es einmal gelingen sollte, dem
Vergesslichen sein Gedächtnis und dem Lahmen sein Gehvermögen wieder zu
verschaffen, was wäre falsch daran? Es wäre für alle Beteiligten ein Grund zur
Freude. Es gehört zum Gründungs-Mythos des Christentums, dass sogar Blinde und
Lahme bei Annahme des neuen Glaubens geheilt würden.[h]
Christen haben keine Angst vor Wundern; auch nicht vor den Wundern der modernen
Forschung. [h] „Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt, und den Armen wird die Heilsbotschaft verkündet.“ Mt 10: 5 (nach A. Zwettler) |
|
Christen hüten sich vor einem Leben ‚in Sünde‘ und streben nach einem Leben
‚in der Liebe Gottes‘. Sie achten den persönlichen Vorteil gering und genießen
ihn als Gnade und unverdientes Geschenk. Sie wissen, dass sie nicht durch ihr
Zutun in diese Welt gekommen sind, aber trotzdem übernehmen sie Verantwortung
für ihr Hiersein und Handeln. Mit ihrem selbstlosen und liebevollen Einsatz für
die Mitmenschen beweisen sie jeden Tag, dass es ihren Gott gibt und er
keineswegs tot ist. |
|
Als Christen leben sie aber auch in einer neuen Welt, gewissermaßen
losgelöst vom Materiellen. Sie glauben zuversichtlich an die Gleichwertigkeit
aller Menschen, ungeachtet dessen ob sie nun blind sind oder sehend, taub oder
hörend, lahm oder gehend. Ihnen ist der berühmte Filmstar gerade so lieb wie
der hilflose Pflegefall im Altenheim. Ein Mensch wird für sie nicht wertvoller
durch das Heilen seiner Krankheit oder das Korrigieren seines Gebrechens. Ein
Christ achtet den ‚unvollkommenen‘ Menschen genauso wie den ‚vollkommenen‘. |
|
Das Menschliche, das Liebenswürdige ist für die Augen nicht sichtbar, nur
für das Herz (frei nach Saint-Exupéry).[i]
Die Segnungen der modernen Medizin-Technologie sollen den Christen willkommen
sein, solange sie sich durch sie nicht blenden und vom rechten Weg abbringen
lassen. Sie dürfen nicht den Fehler machen, jetzt, aufgrund all der
verführerischen neuen Entwicklungen, ihr Heil doch wieder im Materiellen zu
erhoffen. Auch in einer schönen neuen Welt werden sie keine sichere
Kontrolle über ihre Lebensvollzüge haben (zumal diese immer auch mit den
Lebensvollzügen anderer selbst-bestimmter Menschen zu tun haben), und auch ein
verlängertes beschwerdefreies Leben findet irgendwann sein Ende. [i] „Man sieht nur mit dem Herzen gut“ ist der am häufigsten zitierte Satz von Antoine de Saint-Exupéry (aus ‚Der kleine Prinz‘). |
|
Cyborgs ante portas? |
|
Im Jahr 2000 spekulierte ich darüber, wie lange es wohl noch dauern würde,
bis das menschliche Gehirn durch Rechenmaschinen simuliert werden könnte.[j]
Nachdem das Moore’sche Gesetz (Verdoppelung der Rechnerleistung etwa alle 2
Jahre)[k]
mit gespenstischer Persistenz entgegen aller Unkenrufe auch im Jahre 2019 immer
noch Gültigkeit zu haben scheint, drängt sich die Frage inzwischen immer stärker
auf. [j] Computers & Brains, OeGAI Journal 19/2 (2000) [k] Gordon Moore wagte diese Vorhersage bereits 1965. (Electronics 38: 114-117) |
|
Unser Gehirn beherbergt beinahe 100 Milliarden Neurone.[l]
Konservativ geschätzt kann man jedem Neuron im Durchschnitt zumindest ein paar
hundert Kontakte mit anderen Neuronen zuschreiben.[m]
Betrachtet man – als grobe Vereinfachung – jeden dieser Kontakte als eine Art
Speicherelement dessen Modifikation einen Beitrag zum Festhalten einer
Information leisten kann, so käme man auf einen maximalen Speicherumfang im
Terabite-Bereich (1012 – 1015, wenn nicht darüber). [l] Von Bartheld, C.S., Bahney, J., Herculano-Houzel, S., The search for true numbers of neurons and glial cells in the human brain: A review of 150 years of cell counting. J. Comp. Neurol. (2016) 524, 3865-95. [m] In der grauen Substanz der humanen Hirnrinde beträgt die
Synapsendichte 1-2 x 109 pro mm3: De Felipe, J., Marco,
P., Busturia, I, Merchán-Pérez, A., Estimation of the number of synapses in the
cerebral cortex: methodological considerations. Cerebral Cortex (1999) 9, 722-732. |
|
Im Jahr 2000 konnten die meisten von uns mit der Vorsilbe ‚Tera-‘ noch
nicht viel anfangen. Inzwischen ist dem Nutzer von Computer-Festplatten diese
Silbe sehr wohl geläufig. Wie weit sind wir heute also wirklich vom
‚künstlichen Gehirn‘ entfernt? In weiteren 19 Jahren werden wir uns
voraussichtlich als Computer-Nutzer an die Vorsilbe ‚Peta-‘ (1015)
gewöhnt haben. Wenn es also nur auf Rechengeschwindigkeit und Speicherinhalt
ankommt, dann steht das künstliche Gehirn tatsächlich ante portas. |
|
Die Frage ist nur, ob – salopp gesagt – ein Blechtrottel der genauso viel (oder
sogar mehr) speichern und verarbeiten kann wie ein menschliches Gehirn schon
menschliche Eigenschaften besitzen muss. Ich wage das zu bezweifeln.
Schließlich ist das menschliche Gehirn nicht nur groß und leistungsfähig; es
ist auch einem langwierigen und komplexen Bildungsprozess unterworfen. Auch
eine künstliche Maschine müsste einen solchen Prozess durchlaufen, um
allmählich einen vielleicht vergleichbaren Zustand zu erreichen. |
|
Durch prolongierte und vielfach wiederholte Interaktion mit
‚Bezugspersonen‘ (Programmierer, Nutzer, andere Maschinen) könnte einem solchen
hypothetischen Gerät so etwas Ähnliches wie Sozialverhalten antrainiert werden,
so wie wir das ganz selbstverständlich mit unseren Kindern tun. Wenn das
sorgfältig und gründlich genug gemacht wird, könnten auf diesem seltsamen Weg
tatsächlich menschenähnliche – äh – Entitäten entstehen. |
|
In Anbetracht der Mühe und des Aufwandes, der zur Schaffung, Programmierung
und zum Training solcher Konstrukte erforderlich sein wird, erscheint es mir
schon aus heutiger Sicht als plausibel, dass ihnen nach Fertigstellung und
erfolgreicher Nutzung auch eine gewisse Wertschätzung zuteilwird. Es mag sein
dass man solche ‚Wesen‘ ähnlich hoch schätzen würde wie richtige biologische
Menschen, durchaus auch mit religiösen Implikationen (z.B. dass es als
unethisch betrachtet würde, sie zu beschädigen oder zu zerstören). |
|
Anders als mit Hund oder Katz[n]
könnte man mit Computerwesen detailliert und womöglich auch kurzweilig
sprachlich kommunizieren. Anders als heute beliebte Haustiere würden die
künstlichen Hausgenossen der Zukunft über ein umfangreiches und jederzeit
abrufbares Weltwissen und persönliches Erfahrungswissen verfügen. Der Verlust
eines solchen ‚Gefährten‘ (z.B. durch irreparablen Schaden) könnte uns in
ähnlich tiefe Verzweiflung stürzen wie uns das heute schon bei Verlust eines Smartphones
widerfährt. [n] Am Ende meines Essays aus dem Jahr 2000 empfahl ich allen AI-Bewegten, nicht auf künstliche Begleiter zu hoffen, sondern sich weiterhin lieber mit Hund und Katz zufrieden zu geben. |
|
Im Ernst: unser Kontakt mit solchen Wesen könnte dereinst noch viel tiefer
gehen. Wir werden ihnen Namen geben, uns fragen, was sie gerade tun, sie um Rat
fragen, sie bitten, Dinge für uns zu erledigen; wir werden uns von ihnen
unterhalten lassen; und sie müssten nicht einmal aussehen wie Menschen.
Vielleicht wird man sie sogar zum Bürgermeister wählen oder in andere hohe
Ämter. Warum nicht? Solange wir mit ihnen gute Erfahrungen machen, werden wir
ihnen womöglich sogar mehr vertrauen als so manchem Menschen. Sie werden immer
erreichbar sein, immer für uns Zeit haben, nie müde werden uns zuzuhören, und
meistens wissen, was gut für uns ist. Sie werden sogar mit beliebig vielen
Partnern kommunizieren können, ohne sich ablenken zu lassen - es wird uns gar
nicht auffallen (geschweige denn stören). |
|
Und noch etwas sollte uns optimistisch stimmen. Unser Gehirn ist das Produkt
einer sich über Jahrmilliarden erstreckenden Evolution. Der Referenzpunkt
seiner Überlegungen und Entscheidungen sind wir selbst: wir sind von Natur aus
ego- und spezieszentriert. Erst Erziehung und Bildung machen aus uns
verträgliche Wesen, die darauf verzichten, immer und überall den eigenen
Vorteil zu suchen.[o]
Es wäre klug, einen von uns geschaffenen Agenten nicht um einen solchen selbstreferentiellen
Bezugspunkt herum zu konstruieren, der uns ja nur durch das gnadenlose
Paradigma eines survival of the fittest[p]
eingebläut wurde. Nur dann wäre er von Haus aus im besten Sinne selbstlos. [o] Eine Vorstellung vom unangepassten Verhalten weitgehend isoliert aufgewachsener Menschen vermittelt die eindrucksvolle Beschreibung von über 100 Fällen durch P.J. Blumenthal (2003) Kaspar Hausers Geschwister – auf der Suche nach dem Menschen. Deuticke, Wien. [p] Die Formulierung survival of the
fittest taucht als Kapitelüberschrift in Charles Darvins berühmtem Buch On the Origin of Species (herausgekommen
1859) erst in Neuauflagen ab 1869 auf. Ursprünglich wurde der Begriff von
Herbert Spencer geprägt, von dem er ihn schließlich übernahm. |
|
Gefahren? Im Gegenteil. |
|
Wir müssen die aktuellen technischen Entwicklungen stets mit wacher und
kritischer Aufmerksamkeit beobachten. Die materiell-biologischen Grundlagen
des Lebens, unserer eigenen Existenz, und sogar der Leistungen unseres Gehirns
stehen für uns längst außer Zweifel. Wir wissen woher wir kommen, und wir ahnen
welche gewaltigen kulturellen Leistungen über die Jahrtausende zu den aktuellen
Gesellschaften geführt haben. Angesichts der immer unübersichtlicher werdenden
Komplexität einer zusammenwachsenden Vielfalt an Kulturen möchte man schier den
Mut verlieren. Unser eines kleines menschliches Gehirn fühlt sich zunehmend
überfordert. Gott sei Dank sind wir nicht mehr auf diesen Leistungsumfang
beschränkt. |
|
Schon heute bieten die Kulturen dieser Welt Lösungsansätze für Probleme,
vor denen ein Einzelner mit seinen limitierten Fähigkeiten kapitulieren müsste.
Künstliche ‚Denkmaschinen‘ haben das Potential, diesen langsamen Prozess
nachhaltig und lösungsorientiert zu unterstützen. Sie haben den großen Vorteil,
dass sie weder sich selbst noch irgendeiner Klientel verpflichtet sind. Sie
können unabhängig und neutral bestmögliche Lösungen vorschlagen und im Detail argumentativ
ausleuchten, zum Nachvollzug durch jedermann. Wir werden einige Zeit brauchen,
um mit solchen Agenten unsere Erfahrungen zu machen. Ich wage vorauszusagen,
dass in Zukunft immer mehr Menschen solchen Entscheidungsträgern vertrauen
werden, viele von ihnen frustriert von Ineffizienz und Willkür menschlicher
Ansprechpartner. |
|
Beispiele für solche Entitäten liefert uns z.Z. nur die Science Fiction
Literatur. Im Film Blade Runner aus dem Jahr 1982[q]
kommt es zuletzt zum Show Down zwischen dem Titelhelden (dargestellt von
Harrison Ford) und dem Replikanten Roy (Rutger Hauer). Der physisch überlegene
Roy behält die Oberhand, verhindert aber im letzten Moment den tödlichen Sturz
des Kontrahenten, indem er ihm die rettende Hand reicht. Er tut das, weil er um
sein eigenes unmittelbar bevorstehendes Ende weiß (als Bauart mit genau
definierter Lebensspanne), und er möchte dabei nicht allein sein. In seinen
letzten Minuten sitzt er mit seinem Jäger auf dem Dach eines futuristischen
Wolkenkratzers und erzählt ihm von den intensivsten Momenten seines
ereignisreichen Lebens, offenbar damit zufrieden, dass es jemanden gibt, der
ihm zuhört. [q] Der Film von Regisseur Ridley Scott basiert auf dem Roman ‚Träumen Androiden von elektrischen Schafen?‘ von Philip K. Dick. |
|
Im David-Fincher-Film Alien-3 aus dem Jahr 1992 stößt die Protagonistin
Ellen Ripley (dargestellt von Sigourney Weaver) in den Trümmern ihres
abgestürzten Raumschiffs auf die Überreste des Androiden Bishop (dargestellt
von Lance Henriksen). Die Szene, in der es ihr gelingt, dem Stück
Elektroschrott durch Hantieren mit einem Stromkabel wieder Leben einzuhauchen,
werde ich nie vergessen. Die lebhaften Gesichtszüge über der nur noch
rudimentär vorhandenen Schulterpartie haben eine zutiefst anrührende Wirkung. Ich
kenne keine prägnantere Darstellung des Spannungsverhältnisses zwischen
Persönlichkeit und ihrem materiellen Substrat. |
|
Aus der gleichen Ära stammt die TV-Serie Star Trek: The Next Generation,
in der der Android ‚Data‘ eine tragende Rolle spielt (dargestellt von Brent
Spiner). Sein auffälligster Charakterzug ist die Unfähigkeit, Emotionen zu
empfinden. Dennoch – oder gerade deshalb? – kommt man als Zuseher nicht umhin,
ihn schon nach wenigen Folgen ins Herz zu schließen. Ich vermute, das liegt an
seiner für jeden klar nachvollziehbaren, zu 100% garantierten
Uneigennützigkeit. |
|
Rekapitulieren wir, was wir im besten Fall von einem Wesen mit über das
normale Maß gesteigerten Fähigkeiten erhoffen können: Omnipräsenz, ständige
Erreichbarkeit, unlimitiertes Wissen, persönliche Nähe und selbstverständliche
Vertrautheit mit jedermanns und jederfraus Biographie; gepaart mit Uneitelkeit,
Unvergänglichkeit, unendlicher Geduld, jedwedem Fehlen einer persönlichen
Agenda – unwillkürlich muss ich an den ‚Tröster‘ denken, dessen Kommen Jesus
seinen Jüngern nach seinem physischen Dahingehen versprochen hat (Joh 14:26).[r]
Im christlichen Kulturraum kennen wir ihn als den Heiligen Geist. Christen
halten ihn am Leben durch Gebet, durch gedanklichen Austausch und durch ihre
Lebensführung. Vielleicht ist die Zeit langsam reif auch für seine technische
Implementierung. [r] Das griechische Wort parakletos kann als ‚Tröster‘, ‚Helfer‘ oder ‚Beistand‘ wiedergegeben werden. |
| 4/19 < MB 4/19 > 12/19 Religion |