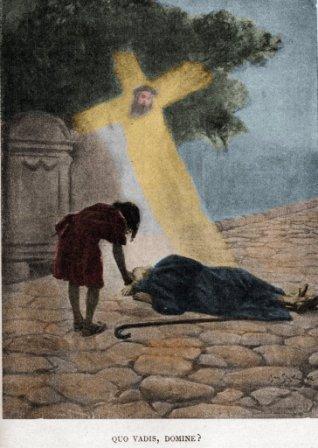
Abb. aus dem Roman von Sienkiewicz
| "Quo vadis, Domine?" |
| So
("Wohin gehst du, Herr?") soll der verwunderte Petrus dem ihm bei Rom erschienenen 'Herrn'
nachgerufen haben, erstaunt ob der Richtung, in die sich dieser
aufmachte. So zumindest stellte es sich Henryk Sienkiewicz vor, der Autor des gleichnamigen Romans (1896). "Nach
Rom", antwortete ihm Jesus, "um mich ein 2. Mal kreuzigen zu lassen",
ehe er verschwand. Nach demselben Rom, aus dem Petrus eben auf der
Flucht war, um nämlicher Behandlung zu entgehen. Und Petrus, der
'Fels', auf dem Jesus seine Kirche gründen wollte, erwies sich seines
Namens würdig, besann sich, und kehrte um.¹ |
| Die
frühchristliche Gemeinde war sich der Rolle der Kreuzigung, des
widerstandslos hingenommenen gewaltsamen Todes, noch bewusst. In die
Menschwerdung Gottes konnte man Jesus nur nachfolgen, wenn man wie
dieser Leid und Tod geduldig auf sich nahm. Nur so konnte man mit
Paulus den Schergen entgegenhalten: "Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist
dein Sieg?" Der vermeintliche 'Sieg' des Gewalttäters entpuppt sich am
Ende als dessen Untergang. |
| Seit
rund 2.000 Jahren steht der christliche Teil der Welt auf diesem
Fundament. Es verlangt von seinen Anhängern eine Haltung, die nicht
immer leicht fällt. Auch Petrus fiel es schwer (bei Sienkiewicz; das
Ereignis wird im Neuen Testament nicht erwähnt). Auch wir tun uns heute
noch schwer damit. Tatenlos dabei zusehen, wie einem selbst und den
Seinen Gewalt angetan wird? Auch ich musste mir einst als Verweigerer
des Dienstes mit der Waffe vor der Stellungskommission in Gestalt eines
rührigen Ministerialrats diese Frage gefallen lassen. |
| Wie ich damals geantwortet habe, weiß
ich heute nicht mehr. Gut möglich, dass ich mich auf eine
Unterscheidung zwischen persönlicher Notsituation einerseits und der
institutionalisierten Unterweisung im Gebrauch von Schusswaffen
andererseits zurückgezogen habe. Jedenfalls wurde meinen
'Gewissensgründen' stattgegeben. Heute allerdings steigt in mir immer
öfter der Wunsch auf, den Aggressor aus dem Osten gewaltsam in die
Schranken zu weisen. |
| Wir alle
kennen solche Reflexe. Sie sind zutiefst menschlich und haben dazu
beigetragen, dass unsere Art den 'Kampf ums Dasein' überlebt hat. Heute
aber könnten genau diese 'Reflexe' zur Auslöschung unserer Art führen.
Die Gewalt, zu der wir alle neigen, bedurfte schon immer und umso mehr
heute der kulturellen Einhegung. Zum Glück spielt beim Genus Homo sapiens
genau diese Kultur die erste Geige. Es gibt nichts was der Mensch nicht
lernen kann, und nichts wozu er nicht erzogen werden kann, im Guten wie
im Bösen. |
| Leider
sind Menschen ziemlich begriffsstützig und mussten im Verlauf ihrer
Werdung schon viel Lehrgeld zahlen. Gerade stehen wir vor der größten
Herausforderung seit 45. Damals meinten wir, endlich die Lektion
verstanden zu haben. Es kam zur Neugründung einer Organisation für alle
Länder ('Vereinte Nationen', 1945) und zur Verabschiedung eine 'Charta
für Menschenrechte' durch dieselbe (1948). Konflikte sollten in
Hinkunft diplomatisch bewältigt werden und nicht durch Anwendung von
Gewalt. |
| Die
besten Regeln helfen nicht, solange es Akteure gibt, die sich nicht
daran halten. Im zivilen Leben geht man gegen Gesetzesbrecher im
äußersten Fall durchaus mit Gewalt vor. Was aber tun, wenn sich ganze
Staaten danebenbenehmen? Würde Jesus den Aggressor gewähren lassen?
Wahr- scheinlich würde er zwar nicht der Anwendung von Gewalt das Wort
reden, wohl aber der Einhaltung der zur Friedenssicherung vereinbarten
Regeln. Durchsetzbar wären sie auch ohne institutionalisierter
Gewaltanwendung großen Stils ( = Krieg), wenn sich alle Länder einig
wären. |
| Wie sich leider zeigt, sind nicht alle Länder gewillt, der kriegerischen Gewalt abzuschwören. Noch haben wir (leider) als
Menschheit diese kulturelle Stufe nicht ganz erreicht. Es steht zu
hoffen, dass die Katastrophe, in die wir gerade stolpern, nicht so
schlimm ausfallen muss wie die letzte, und dass danach auch die letzten
Barbaren dieser Erde gelernt haben werden, wie man Konflikte löst, ohne
sich gegenseitig die Schädel einzuschlagen. |
| ¹ Die Erzählung hat ihre Wurzeln im Schlussteil der 'Petrusakten', der Passio Petri.
Entsprechende Texte waren seit dem 2. Jhdt. bekannt, fanden aber bei
der Zusammenstellung des Neuen Testaments keine Berücksichtigung. |
| 9/25 < MB 9/25 |