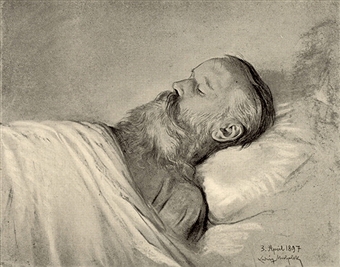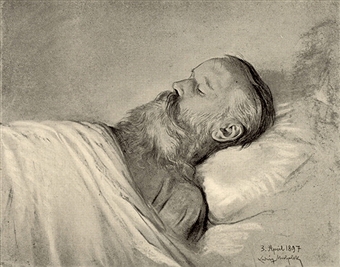Aus längst vergangner Zeit
|
| 'Trotz
aller Mühe, welche auf das Studium des salzsauren Chitosamins
(Glucosamins) bereits verwendet worden ist, sind die positiven
Ergebnisse der Beschäftigung mit diesem Salz, eines chemisch wie
physiologisch gleich interessanten, stickstoffhaltigen Kohlehydrates
bis jetzt recht spärliche.' |
| Mit
dieser nüchternen Feststellung beginnt ein gewisser Robert Breuer
seinen Artikel 'Ueber das freie Chitosamin', erschienen anno 1898 in
der Zeitschrift 'Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft'.
Gestoßen bin ich auf diesen Text aufgrund eines unscheinbaren Verweises
am Ende eines anderen Artikels: 'R. Breuer, Ber., 31, 2193 (1898)'. |
| Breuer? Breuer... Der Name sagte mir etwas. In
Wien war um die vorletzte Jahrhundertwende ein Dr. Josef Breuer
zugange, praktischer Arzt und Inspirator für Sigmund Freud. Einer
seiner Söhne war auch Arzt und hieß tatsächlich Robert. Sollte er
eventuell an der Allgemeinen Poliklinik (so die Adresse des Autors)
gearbeitet haben? |
| Hat er! Wie das Internet
mir unschwer verriet, war der junge Herr Breuer (geboren 1869) zur
fraglichen Zeit tatsächlich dort als Assistent beschäftigt. Die
Allgemeine Poliklinik befand sich seit 1892 in der Mariannengasse 10
und war mit einem für damalige Verhältnisse hochmodernen chemischen
Labor ausgestattet. |
| Woher
sein Interesse für das Kohlehydrat rührte, weiß ich nicht. Mir hat er
jedenfalls nach über 100 Jahren mit seiner Beobachtung geholfen, dass
diese Substanz als Base ziemlich instabil ist. Ich hatte mich die
längste Zeit darüber gewundert, dass eine derart triviale Substanz nur
als Salz diverser Säuren angeboten wird. Allerdings folgte ich nicht
der von ihm beschriebenen Methode zur Darstellung der Base aus dem
Hydrochlorid, denn für solche Zwecke gibt es seit 1947 praktischere
Ionenaustauscherharze. |
| Berühmt
ist Robert Breuer mit dieser Arbeit nicht geworden, wenngleich er es
später zum Chefarzt des Rothschild-Spitals brachte. Eher wird er der
Nachwelt durch einen Zufall in Erinnerung bleiben. Sein Vater betreute
als Hausarzt den Komponisten Johannes Brahms in dessen letzten
Lebenswochen. In der Nacht vom 2. zum 3. April 1897 wachte Robert
Breuer an dessen Sterbebett. |
| In einem Brief an den Brahms-Biographen Max Kalbeck schildert er den Morgen, an dem Brahms starb. 'Als ich gegen ½7
Uhr geweckt wurde (ich hatte darum gebeten, denn ich war damals
Unterassistent an der Klinik und mußte früh wieder im Spital sein) lag
Brahms in tiefer, schlafähnlicher Bewußtlosigkeit. Der Puls war nahezu
unfühlbar geworden. – Ich habe Brahms nicht mehr lebend gesehen: um¼8 Uhr mußte ich gehen.' |
| Wahrscheinlich widmete er sich im Anschluss jenen Experimenten, die zu der von mir heute noch genutzten Publikation führten. |
2/16 < MB 7/16 > 7/16
Music & art
|
|