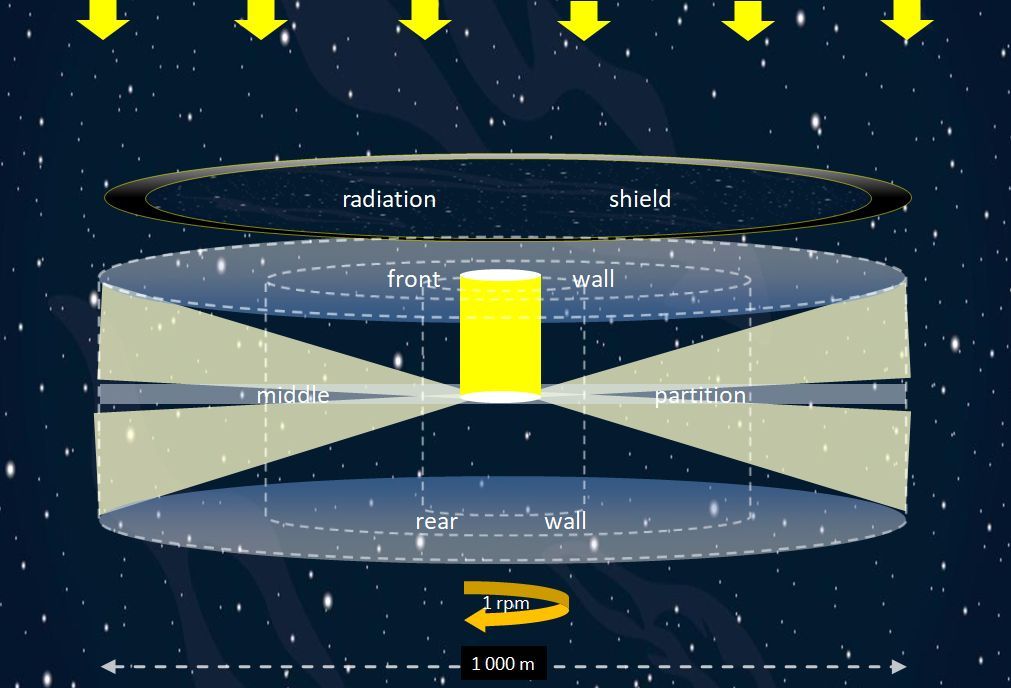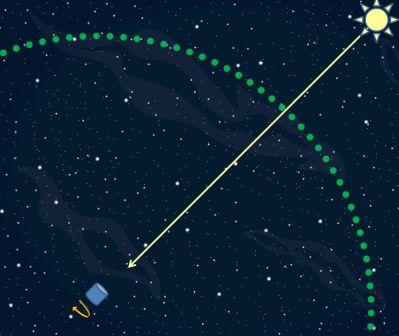
symbolische Anordnung der Ballonaggregate und des Zylinders (nicht maßstabsgetreu)
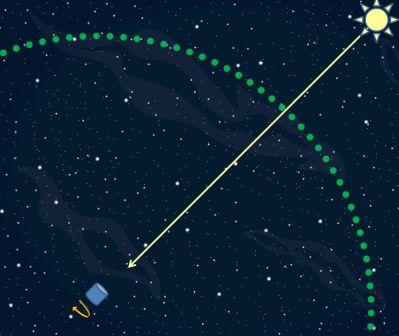
| Kostbare Schwerkraft |
| Wenn
Sie Schwerkraft in einem Raumschiff erzeugen möchten, können Sie es
Captain James T. Kirk gleichtun und den entsprechenden Knopf drücken.
In der realen Welt ist dies jedoch deutlich schwieriger zu
bewerkstelligen. In einer berühmten Abhandlung schlug der Physiker
Gerard K. O'Neill einen rotierenden Zylinder
mit den Abmessungen (Durchmesser x Länge) 4 x 20 und einen
weiteren mit 5 x 20 Meilen vor. Letzterer würde den Bewohnern auf
seiner inneren Oberfläche eine erdähnliche Schwere verleihen. Dazu
müsste man diesen Torus lediglich etwas mehr als 28 Mal pro Stunde um
seine Längsachse drehen. Als Sahnehäubchen fügte Prof. O'Neill noch
einen bescheidenen „äußeren landwirtschaftlichen Ring“ mit weiteren 20
Meilen Durchmesser hinzu. |
| Der
entstehende Lebensraum könnte mehrere Millionen Menschen beherbergen.
Wahrscheinlich hatte der Designer dabei die Bevölkerung New Yorks
vor Augen – für ihn (der von dort stammte) naheliegend. Ich frage mich,
ob eine solche Dimension geeignet wäre, die Menschheit in einer
planetaren
Notsituation zu retten. Nach einem katastrophalen Asteroiden-Einschlag
auf der Erde ginge es eher um das Überleben als Spezies als darum,
Kolonisten ins All zu schicken. Nach dem Verlust der technischen
Unterstützung von Seiten der Erde müssen die Überlebenden im Weltraum
die Möglichkeit haben, ihre Lebensgrundlagen selbst zu erhalten. |
| Daher
sollte der Vorschlag auf eine menschlichere Größe reduziert werden.
Motivation und Organisation in einer Population von einigen Tausend sind besser und leichter zu erreichen; und einige Tausend
würden immer noch eine gesunde genetische Mischung ermöglichen. Es mag
möglich sein, einige Jahre in einer Ansammlung von Ballonstationen mit Mikrogravitation
zu überleben (siehe 'Transient human habitat in outer space'). Um jedoch
über Generationen hinweg zu bestehen, bräuchten wir wahrscheinlich
etwas Ähnliches wie Schwerkraft. Hierfür sollte ein kleinerer Zylinder
mit (Durch- messer x Länge) 1.000 x 400 m ausreichen. Bei einer Umdrehung
pro Minute erfährt die Besatzung angenehme 56% der Erdgravitation. Das
könnte ausreichen, um negative gesund- heitliche Folgen der
Schwerelosigkeit zu verhindern. |
| Der
wissenschaftliche Fortschritt könnte es in naher Zukunft ermöglichen,
im Weltraum leichte Zylinder (spezifische Masse < 2 g/cm³) zu
errichten. Die Schwerkraft, sei sie natürlich oder „künstlich“, drückt
stets gegen jedes Hindernis, sei es der Boden unter unseren Füßen oder
die Hülle eines rotierenden Zylinders, und zwar mit einer Kraft, die
proportional zur Masse des Objekts ist. Während wir Böden üblicherweise
aus Stahl und Beton bauen, sollte im Weltaum Kohlefaser oder sogar
Graphen das Material der Wahl sein. Die Wand eines rotierenden
Zylinders muss nicht nur die gegen sie drückenden Objekte tragen; sie
muss sich auch selbst tragen und Strahlungsschutz, Wärmeisolierung und
absolute Dichtheit gewährleisten. |
| Ein
erster Schritt könnte die Errichtung eines hexagonalen Gitters aus Kohlefaser (oder einem noch zu entwickelnden besseren
Material) sein. Es hält in 3 Schichten Fächer zum Einfügen von Platten mit 1 m Durchmesser bereit.
Sie sind 10 cm dick und halten 15 cm Abstand voneinander, wodurch
zwischen ihnen 2 gleich große Hohlräume entstehen Das spart Gewicht und
ergibt gute Wärmedämmung. Man erhält eine riesige Anzahl von Kammern,
vorstellbar als harter
Schaum im großen Maßstab. Gesamtdicke 0.6 m, mittlere Dichte 1 g/cm³
(ca. 45 % Hohlraum). Während die Platten für dichten Abschluss sorgen,
steht das Gitter für die Stabilität. Diese könnte durch ein zugfestes
Seil gewährleistet werden, das in Hohlstäben über Lager gespannt
jeweils 7 Elemente zusammen spannt (siehe pptx Datei am Ende des Textes). |
| Außerhalb
des Erdmagnetfelds, das geladene Teilchen des „Sonnenwindes“ ablenkt,
wären wir schädlicher Strahlung ausgesetzt. Aus diesem Grund benötigen
beispielsweise auf dem Mars (ohne ein solches Feld)
Habitate eine dicke, kompakte Abschirmung von mindestens einem Meter.
In unserem Fall dringt die Sonnenstrahlung ausschließlich durch die
Vorderseite ein. Statt die gesamte Hülle des Zylinders mit unnötiger
Masse auszustatten, sollten wir die Strahlenschutz- maßnahmen auf die
Vorderseite konzentrieren. Die Bewohner werden in den äußersten
Randbereichen des rotierenden Torus wohnen. Um sie vor der Strahlung zu
schützen, könnte an der Vorderseite in einigem Abstand (ca. 10 m) von
der rotierenden Masse ein nicht rotierender 50 m starker Ring installiert werden.
Bei einer hohen Massendichte könnte eine Dicke von 1 m ausreichen. |
| Grobe Schätzung ergibt eine Gesamtmasse von ca. 3 Millionen Tonnen
(O'Neill: ca. 3 000 mt). Das Objekt könnte an einem der fünf Lagrange-Punkte
der Erdumlaufbahn um die Sonne errichtet werden, wobei die
Rotationsachse zur Sonne zeigt. Die Kolonie hat an der Vorderseite
ein rundes Fenster (100 m Durchmesser), transparent für möglichst
viel Strahlung (nicht nur für sichtbares Licht). Nahrungsspendende
Aggregate photosynthetischer Ballons kreisen in einer 365er-Kette (17
400 m über dem Zentrum der Kolonie) mit einer Umlaufperiode von 365.26
Tagen (siehe Titelbild). Jedes Ballonaggregat hat einen Durchmesser von
etwa 100 m und
schirmt nachts das einfallende Sonnenlicht ab. Die Masse kann auf 3 000
Tonnen geschätzt werden (ISS: 450). Die Gravitationskraft zwischen
jedem
Ballonaggregat und dem Zylinder beträgt 2.1 Millinewton (zum Vergleich:
1 kg Masse wird auf der Erde mit einer Kraft von 9.81 Newton nach unten
gedrückt). |
| Die
Ballonaggregate folgen einander auf ihrer Kreisbahn um die Kolonie. Der
freie Abstand zwischen ihnen beträgt etwa das Doppelte ihrer
Ausdehnung. Dadurch entsteht ein zirkadianer Rhythmus mit
16-Stunden-Tagen stabiler Helligkeit und langsam beginnenden und
endenden 8-Stunden-Nächten. Sonnenlicht- leitende Glasfasern sorgen bei
Bedarf für zusätzliche Beleuchtung. Die Ballonaggregate können
gelegentlich besucht werden, werden aber in der Regel von Robotern
gewartet. Für den Transport docken kleine Raumschiffe am dunklen Ende
des Zylinders an. Hochenergetische Strahlung hilft Mikroorganismen in
den äußersten Ballons, Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff als
Treibstoff für Düsentriebwerke zu spalten (Herkunft dieses Wassers: siehe übernächster Absatz). |
| Die Weltraum-Exilanten benötigen
zwei Arten von Raumschiffen. Die kleinen transportieren Menschen und
Material zwischen den Stationen im Orbit. Ich rechne mit mindestens
tausend Ballon-Aggregaten insgesamt. Ein paar hundert dieser „kleinen
Raumschiffe“ könnten für ihren Transportbedarf ausreichen. Sie bieten
zwar Platz für bis zu 20 Passagiere, transportieren aber in der Regel
nur zwei Personen plus Fracht. Der zweite Schiffstyp ist für die
voraussichtliche Rückkehr zur Erde vorgesehen. Dies wird ein „one-way-ticket“
für ein paar Tausend Menschen sein. Etwa zehn solcher Schiffe, jedes
für ein paar Hundert Passagiere, könnten auf L2 (L2? Siehe übernächster
Absatz) stationiert werden. |
| Wassereisblöcke
in gasdichten Hüllen können in der extrem kalten Außenluft gelagert
werden. Da es keine Versorgung mehr von der Erde gibt, sind wir auf
lokale Vorräte angewiesen. Glücklicher- weise bietet jedes
Ballonaggregat, das die
Sonne umkreist, ein schattiges Plätzchen in seiner Nähe. Eine
Ballonstation mit 3.000 Tonnen, die die Sonne in 365.26 Tagen umkreist,
wird im selben Zeitraum von jedem Objekt umkreist, das sich in einer
bestimmten Entfernung befindet (unabhängig von seiner Masse; meine
Schätzung liegt zwischen 1 190 und 1 716 m; man muss es ausprobieren).
Wenn beide in derselben Ebene kreisen, eröffnet dies die Möglichkeit,
ein Bündel Eisblöcke dort zu platzieren, wo die Sonne nie
scheint: im Schatten der Station. Sie werden hoffentlich dort bleiben:
Da nur schwache Kräfte am Werk sind, muss die Position gelegentlich
angepasst
werden. Anders als die Masse des Eises wird die Masse der Station von
Einfluss sein und je nach Besuchern, Pflanzenwachstum und Ernte
schwanken. Eisblöcke können auch im dunklen Zentrum gelagert werden (statt eines Ballons). |
| Ein
großer Vorrat an Eisblöcken kann auch hinter dem (dunklen) Ende des
Zylinders Platz finden (nimmt nicht an der Rotation teil,
trägt aber zur Masse bei). Deutlich mehr Wassereis könnte am
Lagrange-Punkt 2 (L2) gelagert werden. Seit 2022 ist das James-Webb-Weltraumteleskop
(6.2 Tonnen) in diesem Bezirk in Betrieb. L2 liegt auf einer Geraden
durch Sonne und Erde, anderthalb Millionen Kilometer weiter entfernt
als die Erde (1 % der Distanz Sonne-Erde). Wegen der enormen Größe der
Sonne (109 Erddurchmesser) erreicht der Kern des Erdschattens L2 nicht
ganz (ringförmige Sonnenfinsternis). Dennoch könnte dies ein guter Ort
sein, um genügend Wassereis zu horten und mehrere Generationen von
einigen tausend Menschen zu versorgen, die sparsam mit Wasser umgehen.
Auch Ersatzteile für die Photosynthesestationen und den Zylinder
könnten dort gelagert werden. |
| Aus
Sicherheitsgründen sollte die riesige innere Halle des Zylinders
luftdicht in zwei Abschnitte unterteilt werden, einen zur Sonne hin und
einen im hinteren Teil. Der Grund liegt auf der Hand: Im Falle einer
Beschädigung der äußeren Hülle könnte die Besatzung in der intakten
Hälfte Schutz finden. Die Trennwand wird ein Fenster von der gleichen
Größe wie die Vorderseite haben, das mit strahlungs-reaktiven Kacheln
ausgestattet ist. Diese nehmen die Energie auf und streuen sie als
sichtbares Licht auf beiden Seiten diffus in alle Richtungen (womöglich
muss ein solches Material erst entwickelt werden). Es sollte ein Vorrat
an Ersatzteilen auf Lager sein, darunter auch solche für die
Außenhülle. Sie besteht aus Standardelementen einer für den Transport in
konventionellen Raumfahrzeugen geeigneten Größe zum Zusammenbau vor Ort. Der Austausch beschädigter
Elemente muss mit lokalen Mitteln möglich sein. Auch die Fenster werden
nicht in einem Stück eingesetzt, sondern aus sechseckigen Kacheln
zusammengesetzt. |
| Obwohl
Zylinder vom Typ O'Neill manchmal mit Straßen und in kleinen Dörfern
gruppierten Häusern dargestellt werden, dürften echte Behausungen in
unserem verkleinerten Maßstab nicht notwendig sein. Die Umgebungs-
bedingungen in den Hallen sollten ein Wohnen im Campingstil
ermöglichen, ganz nach dem Geschmack der Besatzung. Konvektion wird
wahrscheinlich von zur Mitte steigender Warmluft an der Vorderseite
angetrieben. Das sollte zu milden Winden am Boden führen, von hinten
nach vorne. Gebäude zur
Trennung verschiedener Tätigkeiten (Landwirtschaft,
Sanitäranlagen, Unterricht, Produktion, wissenschaftliche Forschung,
Freizeit, Telekommunikation usw.) werden aus statischen Gründen dicht
an den Wänden errichtet. Idealerweise sollten Produktionsanlagen für
alle Module, aus denen die Ballonaggregate und der Zylinder bestehen,
zur Verfügung stehen (inklusive die erforderlichen Rohstoffe). Am
hinteren Ende ist kein großes Fenster vorgesehen, aber ein Blick in den
Sternenhimmel (auch wenn er sich schnell dreht...) wäre schön. Zu
diesem Zweck sollten einige der vorletzten Elemente
(für die Bewohner subjektiv auf Augenhöhe) transparent sein. |
| Bei
der Entwicklung komplexer
technischer Lösungen ist Panik ein schlechter Ratgeber. Ein solches
Projekt muss ohne unmittelbare Bedrohung am Horizont beginnen,
getrieben allein von wissenschaftlicher Neugier. Ein verkleinerter
Zylinder, wie hier vorgeschlagen, wäre für Forschungsorganisationen wie
NASA oder ESA finanziell machbar. Selbst wenn nie ein tödlicher
Impaktkörper auftaucht (hoffen wir es), wäre ein komfortabler
Platz im Weltraum wünschenswert. Wir würden mit mehreren
Ballon- aggregaten beginnen, um die Bedingungen für autarkes Leben im
Weltraum zu erforschen. Der erste Zylinder wird nur für Pflanzen
errichtet (keine Bäume – zu schwer). Wir brauchen Zeit, um den
optimalen Aufbau zu finden. Beispielsweise könnte untersucht werden, ob
ein riesiger zentraler Stabmagnet, der mit dem Zylinder rotiert, den
Sonnenwind ablenken kann (oder genügt schon allein die durch Strahlung
hervorgerufene Ladungsdifferenz zwischen vorne und hinten?). Oder ob
man mit der Errichtung im Erdschatten
auf L2 beginnen und erst nach Fertigstellung des Strahlenschutzschirms
mit der Baustelle an einen sonnigeren Platz übersiedeln könnte. Oder
wieviel IR-Strahlung durch die Vorder- und Mittelwände durchgelassen
werden sollte, um eine angenehme Raumtemperatur zu erreichen. |
| Als
Prof. O'Neill vor einem halben Jahrhundert seinen Zylinder vorschlug,
dachte er an zwei gegenläufig rotierende, um Kreiseleffekte zu
vermeiden. In unserer Zeit mit schnellen und leistungsfähigen Computern
ist diese Vorsichts- maßnahme möglicherweise nicht mehr nötig. Zwar weist
ein Kreisel oft eine ausgeprägte Präzession um die Rotationsachse auf.
Anderer- seits strebt er aber auch gerade wegen
seiner Rotation nach einer aufrechten Orientierung. An strategischen
Punkten positionierte und von schnellen Computern gesteuerte
Düsentriebwerke könnten womöglich jede Abweichung von der stabilen und
vollständig aufrechten Ausrichtung verhindern. Ähnliche Programme
werden die kleinen Triebwerke in den Ballonaggregaten steuern, um
sie auf ihrer vorgesehenen Bahn um die Kolonie zu halten. |
| Jedes
der 365 Ballonaggregate führt im Zylinder zu einer der 365 Nächte eines
Jahres. Es kann für das seelische Wohlbefinden der Besatzung wichtig
sein, ihr irdisches Uhrwerk in Aktion zu sehen. Im Katastrophenfall
nährt dies die Hoffnung der Überlebenden auf eine baldige Rückkehr in
ihre Heimatwelt, wenn nicht für sich selbst, dann zumindest für ihre
Kinder oder Enkel. |
| Aufbau des Zylinders (powerpoint Datei) |
| MB (4/25) |
| overview back to Cosmology & Space Flight
|